Was "AI-Readiness" Wirklich Bedeutet

In den letzten Monaten ist eine ganze Welle neuer Tools aufgetaucht, die versprechen, den „KI-Reifegrad“ von Unternehmen zu messen.
Von Online-Fragebögen bis zu seitenlangen Audit-Berichten – jedes Haus scheint inzwischen sein eigenes Bewertungsmodell zu haben. Microsofts Fünf-Stufen-System ist nur eines der bekannten Beispiele.
Die meisten dieser Assessments leisten solide Arbeit, wenn es darum geht, die vorhandenen Gegebenheiten zu erfassen: Daten, Infrastruktur, Pilotprojekte, Kompetenzen.
Was sie jedoch selten aufdecken, ist das, was wegfallen müsste – überflüssige Routinen, veraltete Entscheidungswege oder Führungsverhalten aus einer anderen Zeit.
Bevor wir also die nächste Messlatte feiern, lohnt eine einfache Frage:
Bewerten diese Analysen wirklich Veränderungsbereitschaft, oder bestätigen sie vor allem den Status quo?
Von Aktivität zu Wertschöpfung
Die meisten Reifegradmodelle stellen die Frage: Wo könnten wir KI am besten einsetzen?
Noch wichtiger wäre die Frage: Womit müssen wir aufhören, um aus unseren KI-Investitionen den größten Wert zu ziehen?
Das ist die Frage, mit der ich meine Workshops beginne. Denn in meiner Arbeit mit Führungsteams liegt das eigentliche Potenzial darin, Wertschöpfungsketten sichtbar zu machen und Teams entlang dieser Ketten zu organisieren.
Damit meine ich nicht, Funktionsbereiche wie klassische Abteilungen, sondern Super-Teams, die für einen gesamten Prozess verantwortlich sind, wie etwa den gesamten Kundenlebenszyklus von der ersten Aufmerksamkeit bis zur langfristigen Bindung.
Experimentierfreude, psychologische Sicherheit, Weiterbildung – all das ist hilfreich. Aber es sind schließlich Hygienefaktoren, die verhindern, dass etwas schiefläuft, nicht jene, die echte Stärke oder Resilienz erzeugen.
Echte Readiness beginnt, wenn
- Führungskräfte bereit sind, Prestigeprojekte zu beenden oder neu auszurichten, wenn sich Chancen oder Risiken ändern,
- Teams überflüssige Arbeit benennen und beenden können, ohne negative Folgen zu riskieren,
- Kommunikations- und Wissensprozesse Spannungen früh sichtbar machen, bevor sie zur Routine werden.
Eine Kultur der KI-Readiness zu schaffen, bedeutet also mehr, als Prompt-Engineering zu perfektionieren oder Automatisierungen einzuführen.
Es heißt vielmehr, die Lern- und Anpassungsfähigkeit zu stärken, überschüssigen Ballast loszulassen und sich konsequent auf das zu konzentrieren, was wirklich Wert schafft.
Der Anfang mal anders
In der Führung geht es oft um eine schlichte, unbequeme Wahrheit: Man muss die Menschen und Situationen so nehmen, wie sie sind – nicht, wie man sie gern hätte. Nur so lässt sich auf Wirklichkeit reagieren statt auf Wunschdenken.
Dasselbe gilt für den Umgang mit KI. Die positiven Möglichkeiten zu skizzieren und dann aufs Beste zu hoffen, ist nichts anderes als eine elegante Form von Beschäftigungstherapie.
Sinnvoller ist es, Assessments zu nutzen, um Dysfunktion sichtbar zu machen. Das heißt, jene Reibungspunkte zu finden, die zuerst gelöst werden müssen, bevor KI tatsächlich Wirkung entfalten kann.
Es fängt mit einem konkreten Engpass an, dort, wo Abstimmung regelmäßig scheitert und die Lösungsfindung ständig Zeit, Energie und Motivation kostet.
Hier beginnt Phase 1 des Forest–Orchard Resilience System (FORS): „Solve One Problem“ – d. h., das Hauptproblem einzeln angehen.
Während dieser Phase werden wichtige Erkenntnisse aufgedeckt, die für spätere Schritte wertvoll sind:
- die Ursachen, die Prozesse jetzt und später beeinflussen.
- die Taktiken, die Teams entwickeln, um nervige Widrigkeiten zu umgehen
- die Verhaltensmuster, die Kultur prägen und verfestigen.
Durch die Beobachtung und Dokumentation dieser Entscheidungen, Gespräche und Einsichten entsteht eine dynamische Wissensbasis und das Fundament von Unternehmensintelligenz. Und Stück für Stück beginnt die Organisation, sich selbst zu entwirren und neu zu verdrahten.
Echte KI-Readiness benötigt keine weitere Kennzahl, kein hübsches Dashboard, sondern ein System, das ständig dazulernt, indem es seine eigenen Reibungspunkte ernst nimmt.
Denn eines ist sicher: Die Werkzeuge und Spielregeln der KI werden sich ständig verändern. Was bleibt, ist die Fähigkeit eines Unternehmens, aus seiner eigenen Komplexität zu lernen.
Das ist das wahre Maß an Readiness, und der einzige Vorsprung, der sich nicht automatisieren lässt.
Für einen tieferen Einblick in die vier Phasen des FORS-Modells können Sie das FORS Executive Briefing hier herunterladen.
Subscribe to the FORS Report
Be the first to know - subscribe today


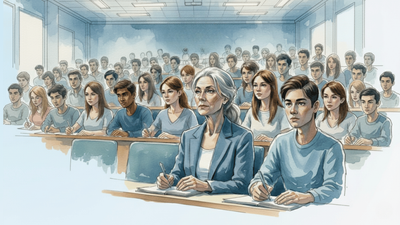


Member discussion